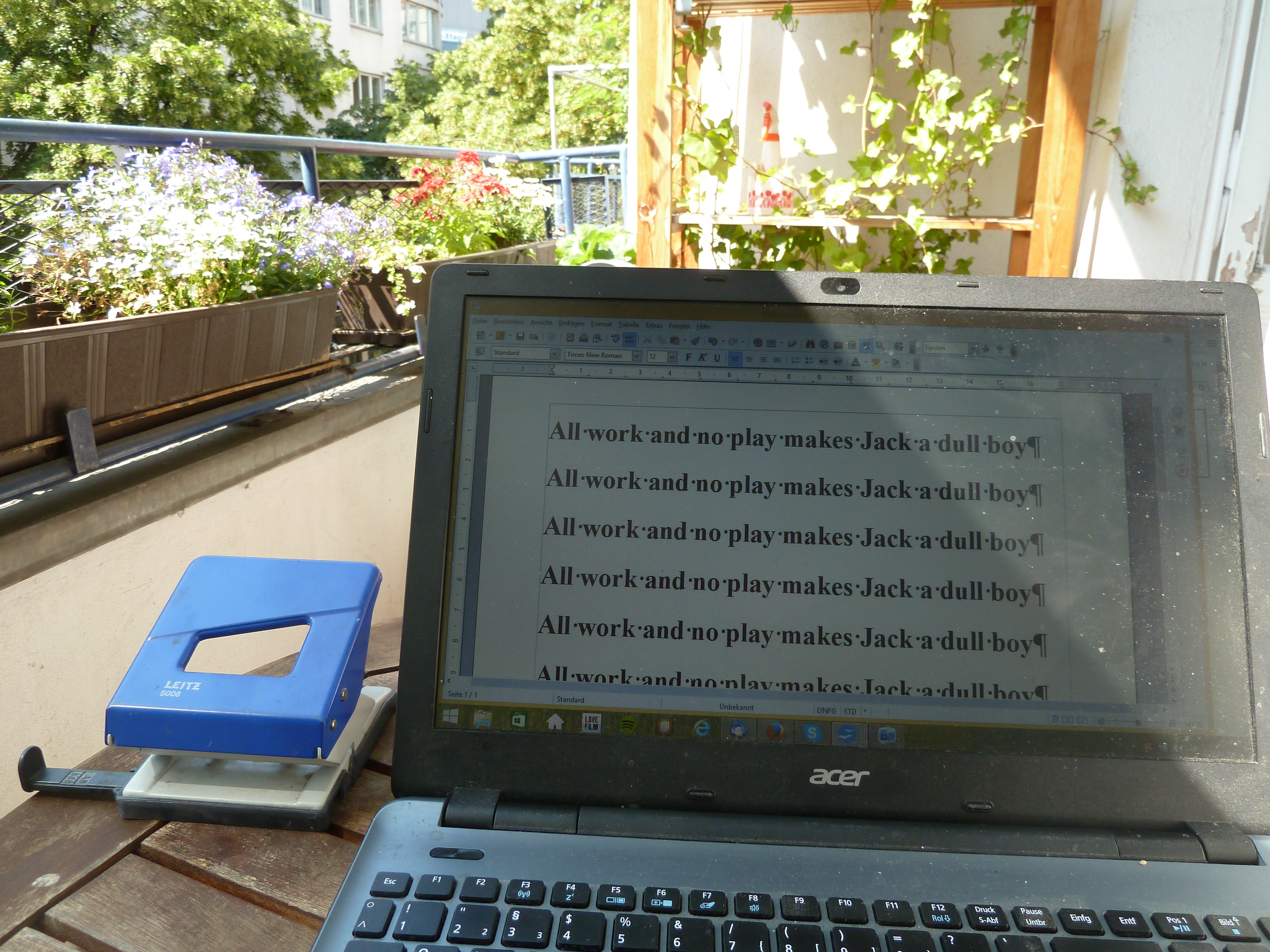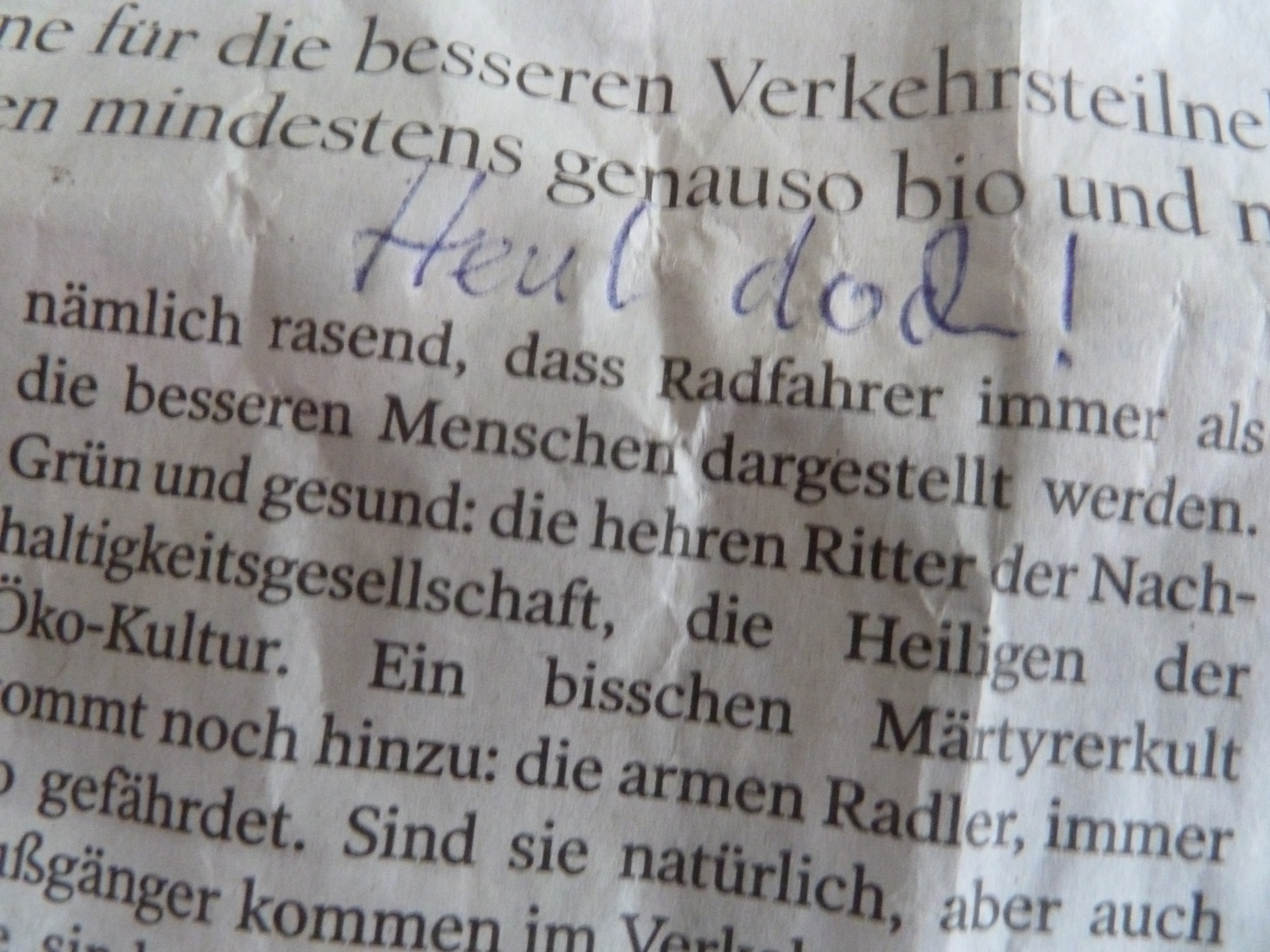Seit die Grünen gemerkt haben, dass sie Arme und Ausländer eigentlich doch eher doof finden, konzentrieren sie sich auf eine neue Klientel unter den Schwächsten der Schwachen: die Insekten, und dabei besonders die Bienen, unsere flauschigen Obersympathieträger unter den Hautflüglern. Warme Milch mit Honig, Biene Maja, Bienenstich mit Puddingfüllung: Damit wird bald Schluss sein; man rechnet mit einem Insektenschwund von achtzig Prozent. „Merken kann es jeder Autofahrer daran, dass er die Windschutzscheibe kaum noch von toten Insekten reinigen muss“, sekundiert die Süddeutsche Zeitung mit eigenen Forschungsresultaten, gesponsert von BMW.
„Die Orientierung der Bienen wird durch Umweltgifte, elektromagnetische Strahlung in der Atmosphäre sowie ein Übermaß an verwirrenden Hinweisschildern gestört“, bestätigt Hedwig Klapproth (42), Insektenreferentin der Grünen im Wahlkreis Remscheid-Dörfeld. „Oft bringen Passanten vollkommen apathische Exemplare zu uns ins Parteibüro. Denen müssen wir dann alles von Grund auf neu beibringen: Tanzen, Sammeln, Bestäuben. Im Garten hinter dem Haus lehrt ein pensionierter Tanzlehrer unentgeltlich Schritte von Walzer über Rumba bis zur Warnung vor einem Wespenangriff; andere Ehrenamtliche setzen die Tiere auf Blüten, massieren ihnen den Rücken und sprechen beruhigend auf sie ein. Nach ein paar Monaten werden sie ausgewildert, doch leider stehen viele schon zwei Tage später wieder dumm brummend vor der Tür. Manche scheinen richtiggehend süchtig nach Pestiziden zu sein und setzen sich extra in besonders belastete Wiesen und Felder. Bei denen müssen wir vor dem Trainingsprogramm zunächst einen Entzug durchführen.“
Und als wäre das der Schwierigkeiten nicht genug, mobben sich die Insekten auch noch gegenseitig. Spinnen killen Mücken, Wespen töten Fliegen und ein Bienenvolk, das sich die Varroamilbe ausgeguckt hat, braucht auch keine Chemie mehr, um auszusterben. Warum halten die Mädels nicht wenigstens zusammen, wenn ihnen das Wasser doch schon bis zum Hals steht?
Auch im seriösesten Medium aller Zeiten hat jemand einen Clip gepostet, in dem man der Welt im Zeitraffer beim sukzessiven Verrecken zusehen konnte. Und zwar wegen der fehlenden Insekten. Gezeigt wurde eine Kausallawine infernalischen Ausmaßes: Erst krepierten die Mücken, dann die Mäuse, dann die Eulen und so weiter. Am Ende standen wie in dem Film „WALL E“ nur noch rauchende Ruinen rum, dazwischen ein verrosteter Wäscheständer oder so – man konnte es nicht genau erkennen –, doch der Sonnenuntergang im Hintergrund war sehr schön. Lebewesen allerdings Fehlanzeige. Zum Glück war das nur Facebook.
Ich selber hatte für Insekten meist nur Totschlagargumente übrig. Die böse Bremse, die lästige Laus, die garstige Gnitze: Sie alle standen gewaltig unter meiner Fuchtel, sobald ich mich nur ins Freie begab. Auch die wenigen Insekten, die es schafften in meine Wohnung einzudringen, bezahlten ihre Keckheit mit der letzten Ruhe in offenen Gräbern an den Wänden – ihre Grabsteine waren sie selber. So mancher Kakerlake wies ich gar mithilfe eines Profikillers die Tür ins Jenseits. Am allerschlimmsten fand ich jedoch stets die Schmetterlinge mit ihrem eitlen Gegaukel. Wenn ich die bloß von weitem sah – gaukel, gaukel, gaukel -, traten mir schon automatisch Tränen des Zorns und der Abscheu in die Augen und ich dachte bloß noch eins: Auf die Fresse!
Aber zu kurz gedacht – das sehe ich jetzt auch ein. Mit Insekten verhält es sich ein bisschen wie mit der Polizei: Man assoziiert sie gern mit etwas Unangenehmen und bekommt auch schnell ein komisches Gefühl bei ihrem Anblick. Dennoch hätte ihr plötzliches, ersatzloses Verschwinden wahrscheinlich keine guten Folgen – da haben die Grünen ausnahmsweise Recht. Bevor man also bessere Ideen entwickelt hat, die mannigfaltigen Funktionen der Insekten auszufüllen (z.B. winzige Bauarbeiter statt Ameisen), muss man sich notgedrungen um den Erhalt der Kerbtiere kümmern (erstaunlicherweise sind selbst Granatenarschlöcher wie die Wespe ohnehin geschützt).
Daher habe ich mich mit anderen Freiwilligen zum Insektenzählen gemeldet – irgendwer muss ja auf die achtzig Prozent Schwund gekommen sein. In mühseliger Kleinarbeit werden die Insekten eingefangen, gezählt, beringt und wieder freigelassen. Die Beobachtung der Windschutzscheiben ist nämlich eine ungeeignete Methode: Natürlich haben die pfiffigen kleinen Kerlchen im Laufe von Abermillionen Generationen gelernt, den Autos auszuweichen. Bevor sie eine Autobahn überqueren, gucken sie mehrmals nach links und nach rechts. Zirpen oder summen sich Warnungen zu. Und zur Not warten sie eben. Die wenigen Insekten, die dann noch auf der Scheibe landen, sind meist unerfahrene Jungtiere oder auch ältere männliche Individuen, die das Nachlassen ihrer Grundschnelligkeit nicht wahrhaben wollen. Und so sind es in der Mehrheit die alten Patriarchen (oft Mistkäfer oder Holzböcke), die hinterher im grauen Eimer an der Autobahntankstelle schwimmen.