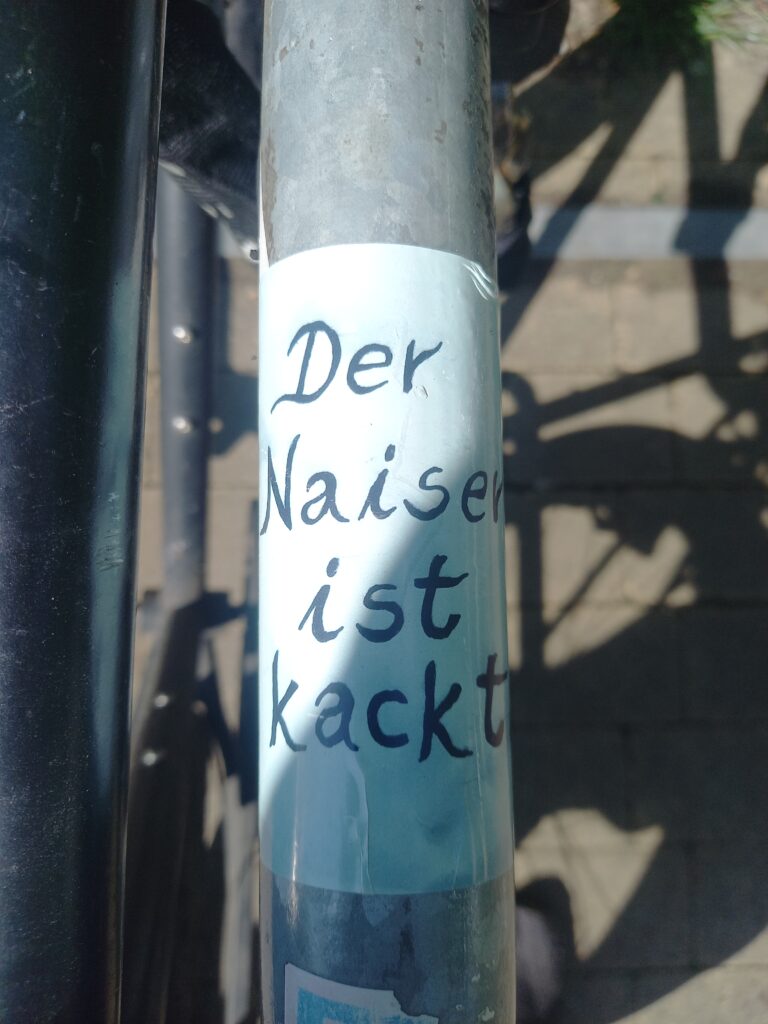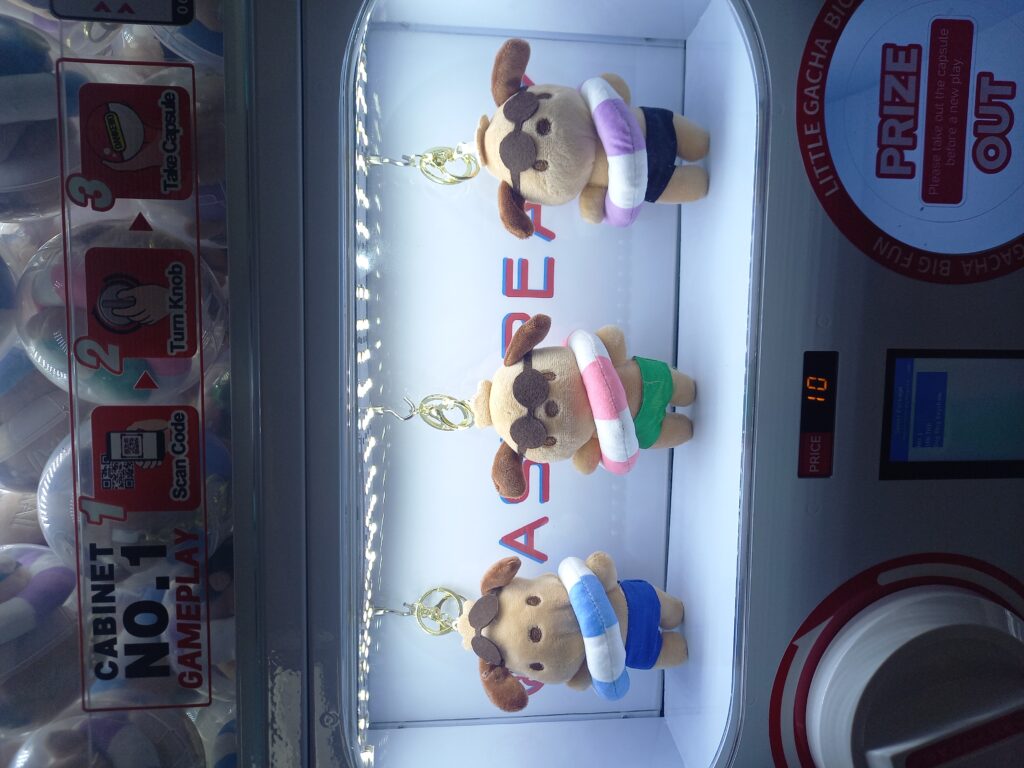Das Alter ist gekommen, ein Umzug in ruhigere Gefilde steht an. Und was würde sich da für urbane Best Ager wie uns besser eignen als ein Bezirk für hippe Alte, ein Kreuzberg light, ein Neukölln für Reiche; schwerer Rotwein statt pissiges Craft Beer oder olles Schultheiß – Schöneberg wir kommen.
Denn, wo wir wohnen, ist es nicht mehr auszuhalten. Krach, Stress, ein Ballermann für billigfliegende Sauftouristen aus der ganzen Welt – nonstop Rambazamba auf der singenden Nervensäge in Dur und Moll. Wir versuchen, den Rückzug nicht als Kapitulation zu sehen, als demütigende Flucht aufs Altenteil; auch befinden wir uns in guter Gesellschaft: Viele kommen jetzt zum Sterben hierher, auf diesen Elefantenfriedhof mit integriertem Sushi-Restaurant; Freunde leben schon dort, und es soll ja Leute geben, die wohnen sogar in Steglitz oder so. Dagegen schlägt hier ja noch direkt der Puls der Metropole, wenngleich nur schwach.
Dabei habe ich gar nichts gegen Steglitzer, im Gegenteil, einige meiner langweiligsten Freunde sind Steglitzer, und machen einfach ihr Steglitzding: Fuchs und Hase zu Bett bringen, vorlesen und gute Nacht sagen, den Bierpinsel anstarren, ab und zu am Birkbuschkanal Chrystal Meth rauchen. Echte Berliner kommen nun mal oft aus Marzahn oder Karlshorst, aus Reinickendorf oder eben Steglitz. Sie konnten sich das nicht aussuchen, sie können nichts dafür.
Ich wohne zwar auch schon 40 Jahre in der Stadt, aber gerade das enttarnt mich als in Unehren ergrauten Eventjugendlichen, der es sich eben schon aussuchen kann; damals wie heute. So achten wir bei der Auswahl des neuen Heims bereits darauf, dass das Haus auch einen Fahrstuhl hat. Damit ist die letzte Lebensphase eingeläutet, oder die vorletzte vor der Seniorenanstalt. Es wird ein langsames und vitales Dahinscheiden, wenn alles gut geht, noch weitere 20 oder 30 Jahre lang. Klug checken wir ab, dass es dort auch ein paar junge Familien gibt, die später für uns die Einkäufe erledigen können, wenn der Rollator in der Werkstatt steht. Und wenn es riecht, können sie die Feuerwehr rufen, die Polizei oder das Bestattungsinstitut.
Doch vor den Einzug haben die Götter den Auszug gesetzt. Weil wir nun endgültig zusammenziehen, ist es vor allem an mir, mein obstkistenartiges Altstudentenmobiliar zu entsorgen. Einiges verschenke ich, anderes fällt beim Zerlegen schon von selbst auseinander.
Beim Verklappen des Sperrmülls stelle ich mich mehrmals irgendwie dumm an, und werde dafür von den Müllleuten jedes Mal verhöhnt, zurechtgewiesen oder angeschrien. Und stets habe ich dabei das vage Gefühl, es auch verdient zu haben. Ein Hauch von französischer Revolution liegt in der Luft. Die Anschisse der Müllwerker sind eine Guillotine light, mit der sie den privilegierten Sesselpuper rasieren. Für mich sind das kathartische Momente. Von Müllmännern angepflaumt zu werden, ist wie ein Ablass für mein schlechtes Gewissen, weil sie in meinem stinkenden Dreck schuften, während ich mich, das verwöhnte Dichtermäulchen mit erlesenem Eiskonfekt beschmiert, in seidenen Kissen aale. Hätte ich nicht das Glück, wegen des Umzugs fast täglich angebrüllt zu werden, müsste ich mir eigentlich eine CD mit Müllmanngepöbel besorgen und abends vor dem Einschlafen anhören, um etwas für mein seelisches und politisches Gleichgewicht zu tun.
Nach dem endgültigen Umzug ist es in Schöneberg dann erst einmal komisch. Ihrem Umgangston nach zu schließen, sitzt die Hausverwaltung in Nordkorea. Bereits bei unserem ersten, und hoffentlich auch letzten Anruf dort, wird uns unmissverständlich klar gemacht, dass wir von ihnen nichts zu erwarten haben, keine Auskunft, keine Hilfe, noch nicht mal Restspuren von Höflichkeit, und gefälligst nie wieder anrufen sollen. Im Anschluss legen sie einfach nur grußlos auf, da sie uns durch die Telefonleitung hindurch nicht anspucken können.
Nachdem ich eine alte Mail zu Gesicht bekomme, in der dieselbe Verwaltung die eingesessenen Mieter unseres neuen Hauses de facto für den Stresstod einer Mitarbeiterin verantwortlich macht, weil sie den Papiermüll nicht ausreichend zerkleinert haben, komplettiert sich das Bild einer von pathologischer Déformation professionelle zur Unkenntlichkeit zernagten Seele. Willkommen in Schöneberg.
Auch die notorische Kontrolltante darf am neuen Ort nicht fehlen. Schon am ersten Tag brieft uns eine Hilde im Hof ausgiebig zum Thema Müllentsorgung. Ob sie Zuträgerin der meschuggen Verwaltung ist, oder hier auf eigene Faust ihrem Hobby nachgeht, müssen wir noch heraus bekommen. Bis dahin Vorsicht. Und davor und danach ebenfalls.
Bereits die ersten Begegnungen mit der neuen Blockwärtin haben uns mit Müllscham geimpft, und zu Bittstellern konditioniert, die eigentlich kein Recht auf Müll haben. Die Benutzung der Mülltonnen ist eine Gnade, die man sich über Jahre hinweg verdienen muss, und wir sind hier die Greenhorns, die sich erst mal ganz hinten anstellen müssen. Die Tonnen sollen sauber und leer bleiben. Und da so ein Einzug mit entsprechenden Baumaßnahmen zunächst sogar noch mehr Dreck als gewöhnlich verursacht, bringen wir den Abfall nur noch nachts raus. Nachts, wenn Hilde schläft.

Doch wer weiß, ob sie für solche Fälle nicht eine versteckte Wildtierkamera bei den Tonnen installiert hat. Vielleicht sollten wir den Müll besser auf dem Balkon sammeln, und, sobald der überquillt, verbrennen.
Es müssen nicht immer schreiende Müllmänner sein. Das entschlossene Regiment einer alten Dame tut es auch. Es gibt Regeln für die Glastonne, Regeln für die Papierbehälter, Regeln für die Verpackungen, Regeln für den Restmüll. Regeln, die unbedingt befolgt werden müssen, sonst. Sonst werden wir wahrscheinlich in unser Elendsquartier rückgeführt. Und ich dachte immer, Prenzlauer Berg wäre die große schwäbische Exklave.
Apropos Prenzlauer Berg, die neue Umgebung ist überraschend weiß. Auf mich langjährigen Südostwestberliner wirkt so eine arisch gentrifizierte Zone seltsam, es ist fast wie in Ostberlin. Ansonsten passt die Bevölkerung eher in die Kategorie, die ich bislang unter dem Titel „typische Kreuzberg-61-Leute“ in meiner verstaubten Denkschublade abgeheftet habe. Nach so einer langen Zeit in Nordneukölln beziehungsweise am Schlesi eine etwas ungewohnte Klientel. Aber sie sind unser Spiegel. Das sind ab jetzt im Grunde wir; flotte Junggreise, getürmt vor Lärm, Schmutz und Partyvolk. Bestimmt wachsen uns hier bald bunte Seidenschals und Baskenmützen oder so.
Früher bin ich ständig umgezogen, da war das überhaupt kein Thema. Jetzt aber fühlen wir uns anfangs in einem Maße fremd und entwurzelt, das wir beide nicht für möglich gehalten hätten. Wir vermissen sogar die Crackraucher im Hauseingang, die Scherben auf dem Radweg, den pausenlosen infernalischen Krach Tag und Nacht, die stulle vor der Haustür herumtaumelnden Touristen mit ihren Sonnenbrillen bei jedem Wetter.
Auch positive Dinge fallen mir erst jetzt nach dem Zuzug auf, weil ich in den letzten Jahrzehnten nur sporadisch in der Gegend war. Zwischen Parks und Bahnstrecken entdecke ich quasi eine neue Stadt, mit einem intelligent geplanten Netz breiter Fahrradstraßen, zum Teil mit eigenen Brücken, durchs Grüne entlang der Bahntrasse. Hoffentlich bekommt die Berliner CDU davon nichts mit; wenn die merken, was hier los ist, machen die da gleich eine Autobahn hin. Es ist fast wie in Kopenhagen; alles ergibt so viel Sinn, dass mich die Irritation darüber an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Wo bleibt der vertraute Hass auf die Bürger, das ist nicht mehr mein Berlin.
Zur neuen Infrastruktur gehört auch der größte REWE, den ich je gesehen habe, ein gigantischer Supermarkt, die Mutter aller REWEs, quasi eine eigene Stadt mit eigener Tiefgarage, ach was, ein eigenes Land von der ungefähren Größe des Saarlands, ein Schlaraffenland mit Kassenbereich. Es dürfte Jahre dauern, bis wir uns in den hundert Gängen auskennen und wissen, wo was steht. Die Schöneberger wissen zu leben, der Lebensmitteleinkauf ist der Sex des Alters. Oder war es umgekehrt?
Dazu kommen in Gehweite die beiden größten Biosupermärkte, die ich je gesehen habe, eine LPG und eine Bio-Company, irreal wirkende, wie vom Uranus gefallene, lichtdurchflutete Raumstationen eines postmodernen Lifestyles. Ich fühle mich in eine Utopie versetzt, in der Veganer sämtliche anderen Lebensformen verdrängt, und das Kommando über den Planeten übernommen haben. Die Zukunft ist da, und wir sind jetzt ein Teil von ihr.
Fragt sich nur, wie lange noch? Einen hübschen Friedhof haben wir immerhin schon in der Straße, zum Bersten voll mit Promiüberresten. Zwischen diversen Normalos liegen Rio Reiser, Thomas Gottschalk und Dieter Hallervorden oder was weiß ich. Auch die Gebrüder Grimm haben hier ihre Glassärge geparkt.
Allerdings geht es in dem Friedhof steil bergauf. Es ist bestimmt anstrengend, dort am Hang zu liegen. Von wegen „ewige Ruhe“, ächz. Jetzt jogge ich zwar neuerdings im Gleisdreieckpark, aber nach dem Tod brauche ich eigentlich kein Fitnessprogramm mehr. „Tote schwitzen nicht“, weiß ein transsylvanisches Sprichwort. Friede meiner Asche, und lieber ein Seebegräbnis, vielleicht ja im Schlachtensee – da fährt von hier aus auch direkt die S-Bahn hin.
Das wird mich mit den Kollegen versöhnen, denn speziell im Lesebühnenumfeld schlägt jeglicher Form nicht zielgerichteter Bewegung Argwohn entgegen. Sport ist hier ähnlich verpönt wie Kinderpornografie. Jeder Atemzug, und jede Muskelzuckung, die nicht ausschließlich dazu dienen, sich selbst oder einen Gegenstand aus existenziellem Anlass – sprich Ortswechsel, Lebenserwerb oder Nahrungsaufnahme – von A nach B zu bewegen, gilt als mit dem Ruch eines faschistoiden Askesegedankens behaftet.
Am Ende leben wir uns aber doch bald ein. Uns leise über klassische Literatur und Musik unterhaltend, flanieren wir durch die ruhigen Straßen des Nervenkurorts Bad Schöneberg. Unsere bunten Halstücher flattern träge im milden Frühlingswind. Es ist so still hier. Nur leise hört man weiter hinten die S-Bahn surren, oder schallt der krächzende Ruf eines Drogensüchtigen von der fernen Yorckstraße hoch, trauter Klang einer alten, mehr und mehr in Vergessenheit geratenden Welt, die an die erinnert, aus der wir kommen.