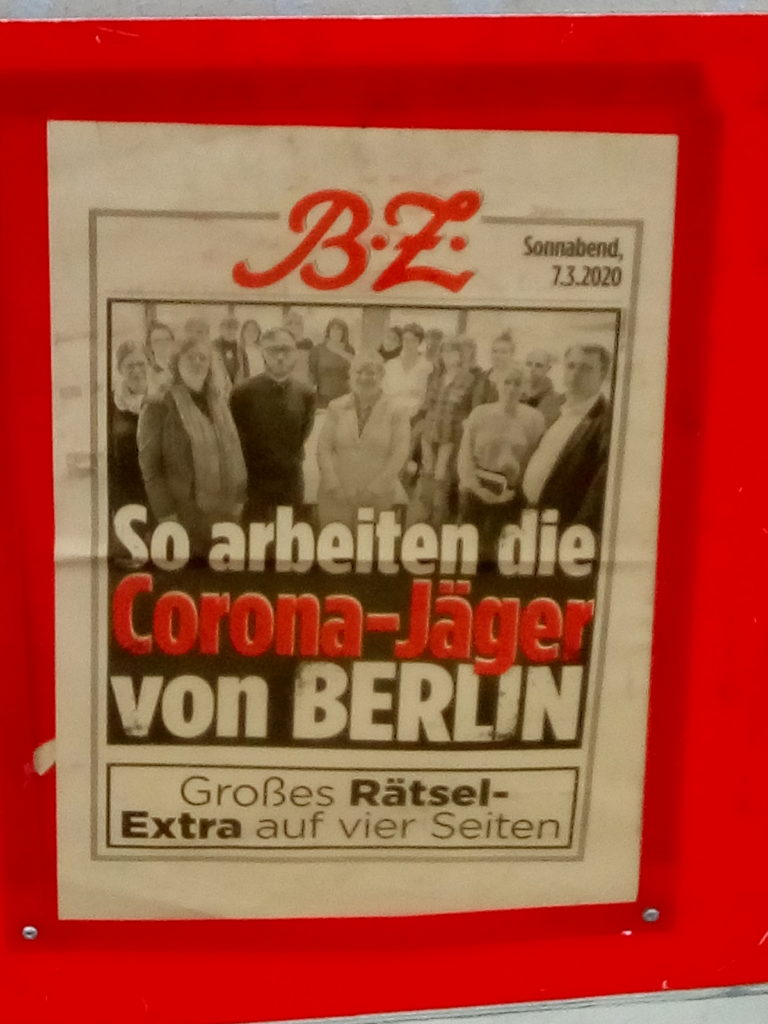„Habt ihr eigentlich die Corona-App?“, frage ich in eine abendliche Runde smarter Akademiker hinein. Keiner hat. Nur einer hatte sie mal heruntergeladen, dann aber wieder entfernt, „weil die nie richtig funktioniert hat.“
Die App ist offensichtlich nicht so weit verbreitet, wie sie sein müsste, damit sie wirklich weiterhilft. Aber ich habe sie. Natürlich. Ich gehöre zu einer bestimmten Blase, die die App verwendet: rührend gutwillige Menschen, die sich ohne allzu großen Aufwand safe, sozial und mündig fühlen wollen. Halbintellektuelle, Halbverantwortliche, Halbkritische und Halbdigitale – die meisten von uns duften gut und haben angenehme Stimmen und Ansichten. Also erst mal schön das glitzy Lifestyle-Feature aufs bereits mit allem möglichen Junk überladene Endgerät gespielt, ohne zu wissen, wie es überhaupt arbeitet. Es funktioniert in der Tat oft nicht, aber das ist in den ersten Monaten egal. Irgendwo ist es ja auch ein Symbol für unsere Akzeptanz der Umstände. Hauptsache, wir haben es, dachten wir. Ist cool. Es passierte ohnehin nicht viel. Das war im Sommer.
Doch jetzt häufen sich wieder die Infektionsfälle, und die Apps schlagen Alarm. Überall fragen die Leute, was das denn nun um Gottes Willen bedeute? Die Panik übersteigt noch die vor der originären Pandemie. Zunächst hatte alle bloß grüne Warnungen. Also Warnungen, die vor gar nichts warnen. „Alles ist in Ordnung“, sagt die grüne. „Ich warne nur ein bisschen. Vor nichts.“ Das ist reine Beschäftigungstherapie. Die Wichtigtuer-App gibt damit an: Ich tu was, ich kann was, ich arbeite. Fragt sich nur, was und wozu.
Eine Freundin hatte mal fünfzehn grüne gesammelt, auf einen Streich. Fünfzehn mal nüscht ist nüscht, habe ich mal in Mathe gelernt. Aber ich gebe zu, ich war trotzdem ein wenig neidisch. Fünfzehn! Alter! Was mich weiter zu der Frage bringt: Kann man die vielen grünen, denn auch irgendwann gegen eine rote umtauschen? Das wäre doch nur fair, das hätte man sich erarbeitet und verdient. Drei Ecken Elfer. Dreimal umgezogen ist einmal abgebrannt. Acht Punkte Fahrverbot. Zehn grüne Warnungen sind eine rote.
Denn die roten gibt es neuerdings ja immer öfter. Seitdem ist vielleicht was los! Doch auch hier werde ich grün vor Neid, als die ersten Screenshots der Angeber mit den rotschicken Warnungen in den sozialen Medien auftauchen. Zusammen mit vielen Fragen: Was ist los, was muss ich tun, wo muss ich hin, wann werde ich sterben?
Die später ebenfalls geposteten Antworten zumindest der Berliner Gesundheitsämter könnte man inhaltlich in etwa so zusammenfassen: „Machense einfach nüscht.“ Bisschen vorsichtiger sein. Vielleicht.
Apropos nüscht. Was war das noch für ein Theater, als die App herauskam. Wir sollen alle zwangsüberwacht werden, hieß es über die am Ende selbst vom Chaos Computer Club geadelte und obendrein freiwillig heruntergeladene App – die Logik erinnerte fatal an den Zwergenaufstand gegen die auch nie geplante „Zwangsimpfung“. Dabei würden die Geheimdienstler an dem unbrauchbaren Datenschrott von mutmaßlich Schimpansenhand (oder -fuß) sowieso verzweifeln. Was ist nur los mit diesem Land, das einst den Kölner Dom, die V1 und den Porsche Cheyenne gebaut hat?
Einmal habe ich eine grüne Risikobegegnung, also ohne Risiko, und schleppe sie zwei Wochen mit; einmal habe ich vier auf einmal, und schon am nächsten Tag sind sie wieder verschwunden. Egal, grüne Risikobegegnungen sind ja eh keine. „Machense jetzt aber mal so wirklich überhaupt jar nüscht“, würde das Gesundheitsamt vermutlich dazu sagen. „Am besten weniger als nüscht.“ Und keine Panik.