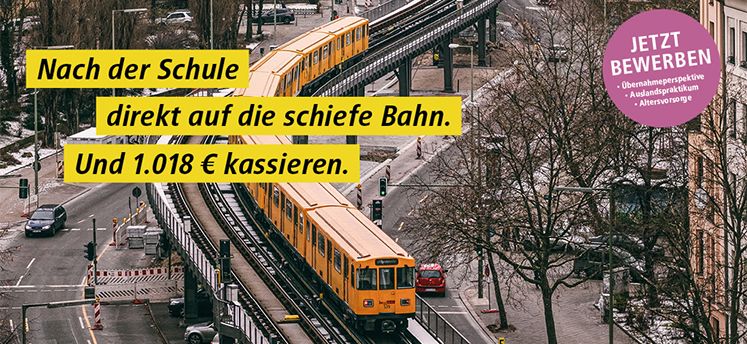Drei Jahre ist Julia Klöckner nun Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Da wird es doch langsam Zeit für eine kleine Bilanz: Wie hat die Gegnerin der gleichgeschlechtlichen Ehe, die die Klimakrise für eine Modeerscheinung hält, dem Amt seitdem ihren Stempel aufgedrückt?
Auffällig ist ihr Faible für Umweltgifte, die Wasserhehler von Nestlé und toughe Landwirte. Was sie jedoch auf den Tod nicht leiden kann, sind ganz offensichtlich Schweine. Auf die hat sie es aber mal so was von abgesehen; das zieht sich wie ein blutigroter Faden durch ihre gesamte bisherige Amtszeit: Ob artfremde Haltung oder Ferkelkastration – so richtig hygge wird ihr erst beim Schweinequälen. Als die gesammelte Schweineschar im März 2018 erfuhr, wer fortan ihre Nemesis und oberste Dienstherrin sein würde, scholl ein entsetztes Quieken durch die Ställe von Schweinfurt bis Eberswalde.
Doch woher kommt überhaupt Julia Klöckners unbändiger Hass auf Schweine? Das ist doch nicht normal, dieser alles verzehrende Hass, der ihr Leben in einem Maße bestimmt, dass davon jede andere Lebensäußerung komplett zugeschüttet wird. Das gilt sogar für die Grundtriebe. Nicht selten müssen ihre Mitarbeiter sie ermahnen, das Atmen nicht zu vergessen, so ausschließlich absorbiert sie ihr obsessiver Schweinehass. Auch für Körperpflege, Sozialverhalten, Sexualtrieb sind keinerlei emotionale, geistige und zeitliche Kapazitäten mehr übrig. Im Fall der Nahrungsaufnahme funktioniert noch am ehesten der Trick, sie daran zu erinnern, dass sie hier ja immerhin ein totes Schwein vernichtet, um ihr auf dem Sprung zwischen Büro und Bundestag mal eben eine Bifi unterzujubeln. In Ausnahmefällen kann das auch zu Übersprungshandlungen führen, in deren Rahmen Klöckner rasend schnell mehrere Kilo Schweinefleisch verschlingt, um diese später unter lauten Flüchen („verfickte Schweine!“) wieder zu erbrechen.
Letztlich lassen sich die Ursachen wie so oft in der Kindheit verorten. In freudiger Erwartung des heiligen Sakraments eilte die achtjährige Julia am Morgen ihrer Erstkommunion fromm den elterlichen Weinberg hinab und auf die malerische kleine Dorfkirche von Guldental zu, als sie stolperte und – batsch! – mit dem blütenweißen Festtagskleidchen mitten in einem Haufen Schweinescheiße landete. Der Tag war verdorben, den späteren Gottesdienst würde das Mädchen notgedrungen im Blaumann ihres Großvaters verfolgen müssen. Wer nun jedoch erwartet hätte, das Kind wäre altersgemäß in Tränen ausgebrochen, sah sich auf erschreckende Weise eines besseren belehrt. Es schüttelte vielmehr drohend die kleinen Fäustchen gen den jäh sich verfinsternden Himmel und schwor mit lauter Stimme, es „diesen Schweinen so richtig zu zeigen – bis an mein Lebensende und so wahr mir Gott helfe!“ In der Ferne zuckten Blitze. Augenzeugen berichten von einer Aura aus Flammen um den Kopf des Mädchens herum sowie von beißendem Schwefelgeruch.
Doch es kam noch schlimmer: Bei einem Ausflug in den Pfälzer Wald wurde ihre liebste Spielkameradin Babsi (B.Z.: „Sie war erst vierzehn!“) von einem wilden Keiler getötet und auf der Stelle aufgefressen. Hinter einem Baum versteckt musste die kleine Julia alles ohnmächtig mitansehen. Die feixende Miene des fiesen Schweins würde sie niemals vergessen.
Angesichts dieser prägenden Vorkommnisse ist es kein Wunder, dass der wiederholte Anwurf ihrer Mutter, doch bitte ihren „Saustall aufzuräumen“, das Kind auf unverantwortliche Weise triggerte und die Traumata stets aufs neue reproduzierte. Sein Herz erkaltete zunehmend, nur ganz tief drinnen loderte brennendheiß der Schweinehass.
Spätestens jetzt beginnen wir zu verstehen, warum Klöckner gegen alle Widerstände und nicht zuletzt die herrschende Rechtslage die quälende Schweinehaltung in zu engen Metallkäfigen bis aufs Blut verteidigt.
Wir sind jetzt bei ihr zuhause. „Dann sperre ich die Schweine eben unten im Fahrradkeller ein“, droht, wettert und weint die Agrarministerin vor ihrer Wohnzimmerwand mit den vom Kleinkaliber durchlöcherten Porträtfotos der Mitglieder des Deutschen Ethikrats. „Dort kann ich mit ihnen sowieso machen, was ich will.“ Man weiß in diesem Moment nicht genau, ob sie die Schweine meint oder die weinerlichen Moralapostel, die den schon seit 1992 verbotenen „Kastenstand“ anprangern.
„Diese gottverdammten Schweine“, knurrt die ehemalige Nahe-Weinkönigin und läuft vor Zorn dunkelviolett an. Zusehends umwölkt sich ihre ebenmäßige Stirn, ballen sich dahinter tiefschwarze Gedanken zu einem Taifun des Hasses. Doch auf einmal lächelt sie verschmitzt. „Dabei will ich ja nur eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum jüngsten Tag, und keine Sekunde länger.“
Das Wissen um ihre Macht über die Schweine als willkürliche Knet-, Quäl- und Foltermasse, lässt sie rasch wieder vergnügt werden. Eine weitere Niederlage wie das seit Beginn dieses Jahres nun doch endlich wirksame Verbot der Ferkelkastration ohne Betäubung wird es nicht geben, hat sich die erklärte Abtreibungsgegnerin geschworen. Sie hat alles versucht, von einer nochmaligen Fristverlängerung bis hin zur Änderung des Tierschutzgesetzes, doch vergebens. Wo Männer beim Gedanken an den Eingriff schmerzhaft das Gesicht verziehen, ist ihnen weder mit Vernunft noch mit Hass beizukommen. Nun nimmt sich die Ministerin stets ein paar Ferkel mit nach Hause – „meine persönliche Tierwohl-Offensive“ –, um sie am Abend in der guten Stube vor dem Fernseher mit der Kneifzange zu verarzten. Das sind natürlich keine 20 Millionen wie sonst jedes Jahr in Deutschland, aber es ist besser als gar nichts.