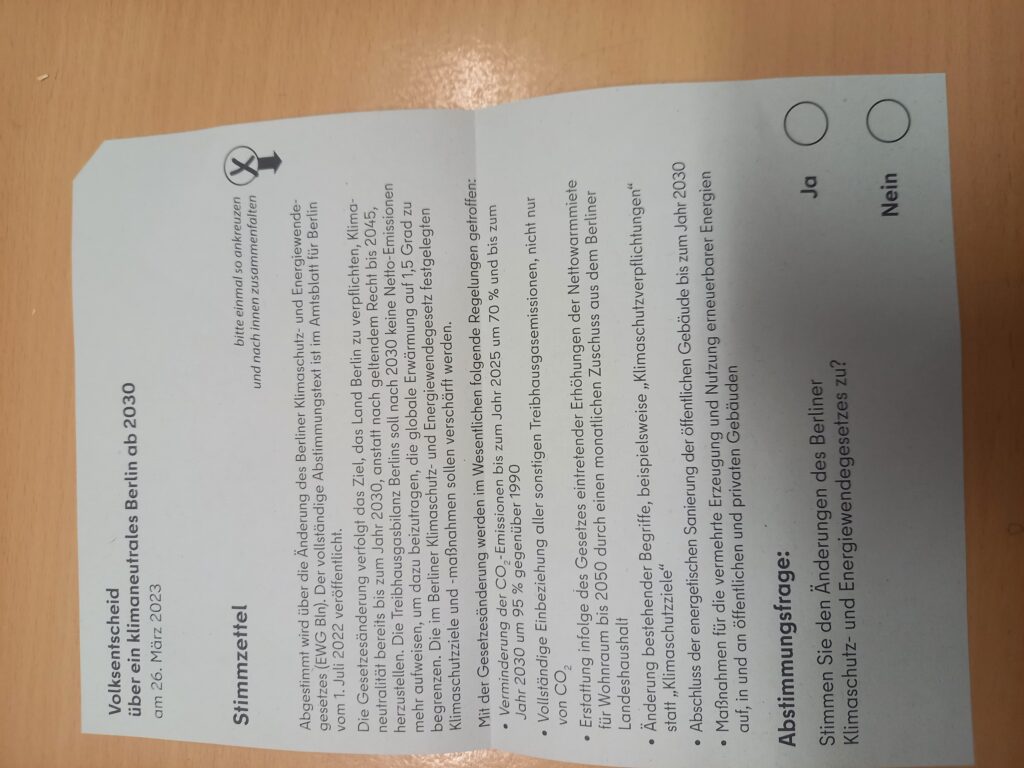Es ist mal wieder einer dieser Tage. Ein junger Typ möchte im Anschluss an unseren Lesebühnenabend mit mir „über den Rassismus in deinem Text“ sprechen. Ich hatte meinen polnischen Urologen in der wörtlichen Rede das „R“ rollen lassen, mit dem für die Selbstleser nachgeschobenen Satz „Er rollt das R sehr schön dabei.“ Sonst keine falsche Grammatik, kein dilettantisch gefakter Akzent, nichts weiter. Ganz davon abgesehen, ist besagte Figur der klare Held in der Geschichte.
Aber egal. „Du, kann ich mal kurz mit dir reden?“, beginnt er draußen vor der Tür des Veranstaltungsorts mit dem bedauernden Unterton eines Kinderarztes, der seinem kleinen Patienten leider gleich ein bisschen weh tun muss. Nur zu seinem Besten, es hilft ja nichts.
Sofort ergebe ich mich in mein Schicksal. Ich weiß, dass ich keine Chance habe, ich kenne das schon. Rechtfertigung zwecklos, auch der Pflichtverteidiger plädiert auf die Höchststrafe. Gern würde ich mich locker herauswitzeln, „… aber die Autobahnen …“, doch mit Mehrdeutigkeit brauche ich dem nicht zu kommen, und mit Humor erst recht nicht. Wir könnten genauso gut von zwei verschiedenen Planeten stammen.
Als ich dennoch versuche, mich schäbig meiner Verantwortung zu entziehen, erstickt er routiniert meine White Tears: „Wenn da jetzt Nazis sitzen würden, könnten die das falsch verstehen.“ Wenn hier auch schon überall Nazis sitzen würden, hätten wir eh längst verloren. Das denke ich, sage aber stattdessen, „wir haben ein gutes Publikum, ich trau denen schon zu, irgendetwas abstrahieren zu können.“
Doch er weiß natürlich, dass das einzig gute Publikum im Raum er und seine Peers sind – die Anderen da drinnen sind eh alle doof, tumbe Claqueure, die besoffen lachend jede Menschenfeindlichkeit durchwinken wie Nero im Colosseum; solche Mitläufer sind im Grunde sogar die schlimmsten.
„Hm, ja“, sagt er, „trotzdem“, und „eigentlich meint das ja vor allem meine Freundin.“ Er zeigt nun auf die junge Frau hinter sich: „Die wollte dir das nämlich sagen.“
Sie sagt aber immer noch nichts, sondern mustert mich nur traurig, ernst und böse, als würde sie gerade ihren Nazi-Opa beerdigen, dabei kocht sie innerlich, doch auch im Einfamilienreihenhaus der Antifa herrscht offenbar noch Ordnung: Die Frau kocht und der Mann führt das Wort. Aber ich verstehe sie auch, es ist eine Sicherheitsmaßnahme, denn garantiert würde ich sie meinem Alter gemäß sonst auf der Stelle sexuell belästigen, ich muss das tun, es liegt praktisch in meiner verfaulten Natur, und das möchte man ja nun auch wieder nicht riskieren, dann sagt halt besser der Paul was, der ist ja auch ein Mann, wenngleich ein guter, falls so was überhaupt geht.
Allerdings ist er selbst kein Pole, denn sonst hätte er ja automatisch recht – ich kann keinem Betroffenen vorschreiben, wovon er sich getriggert fühlen darf und wovon nicht. Mit Betroffenen haben wir es so gut wie nie zu tun. Auch sind es komischerweise meistens Typen, die mich zurechtweisen. Junge weiße Männer können immer alles ganz genau erklären. Man sieht in ihnen schon deutlich die unangenehmsten Eigenschaften alter weißer Männer angelegt, zu denen sie eines Tages sowieso unweigerlich werden. Darauf freue ich mich schon – willkommen im Club!
Er hat jedenfalls getan, was er konnte. Zwar wartet er vergeblich auf ein starkes Zeichen meiner Einsicht wie zum Beispiel einen Brandt‘schen Kniefall oder eine zünftige Selbstverbrennung, doch bestimmt werde ich in Zukunft besser nachdenken, ehe ich die nächsten Faschosprüche raushaue. Dessen ist er sich sicher, so wie er sich in allem äußerst sicher ist.
Und so gehen die beiden wieder rüber, auf die Bank zu ihren Freunden und kiffen, und ich sehe wie stolz und zufrieden er ist; er hat Zivilcourage gezeigt, sein Abend ist vergoldet. Kein Fußbreit den Faschisten! Doch auch ich bin glücklich, denn das habe ich alles allein mit meiner Kunst erreicht, mehr kann ich mir als Autor nicht erhoffen. Nun blicken sie rüber zu mir und lachen – wie fröhlich sie sind, ach, ich liebe diese engagierten jungen Menschen! –, und ich geh wieder rein und hol mir noch ein Bier an der Bar.
Solche Diskussionen haben immer dazugehört, und sollen es gern auch weiterhin. Die Geschmäcker sind verschieden, und vielleicht bin ich ja wirklich ein Arsch – eine grundsätzliche Gefahr für unsere Show hatte ich in derlei Rezeptionsdynamik jedoch nie gesehen.
Doch mit der Zeit rückten die Einschläge näher, bis sie am Ende sogar das halbe Schiff versenkten. Eine Gruppe im Publikum störte sich eines Tages an ein oder zwei unserer Texte, die sich über gendergerechte Sprache mokierten. Doch statt, wie es üblich war und angemessen wäre, ein paar unfreundliche Worte an uns zu richten, uns den Finger zu zeigen, und danach nie wieder zu kommen, setzte sie alle Hebel in Bewegung, um uns, die Autoren, vom Veranstalter maßregeln zu lassen.
Das Urteil wurde gesprochen: Zur Strafe dürfen wir anstatt wöchentlich nur noch zweimal im Monat unsere patriarchal-rassistischen Nationalsottisen zum Vortrag bringen. Das nenne ich dann mal: mit Kanonen auf alte graue Spatzen schießen. Zwar stimme auch ich mit manchen Kollegen absolut nicht überein, aber letztlich haben wir auf der Bühne nicht den Holocaust geleugnet, sondern ein Boomer hat übers Gendern genölt, so what. Das ist doch fast schon seine naturgegebene Bestimmung; andernfalls hielte man ihn wohl für einen V-Mann.
Wahrscheinlich feierten sich die Beschwerdeführenden ab, als hätten sie sich mit „Nuhr im Ersten“ in die Luft gesprengt, und so die Welt zu einer des fein geleckten Wortes gemacht. Die Heldentat betraf aber leider nur ein paar Kleinkünstler, die vor zwanzig Leuten ihr Bühnenhobby pflegen, um hinterher mit zehn Euro in der Tasche nach Hause zu gehen. Und bereits auf diesem Level Meinungen das Podium zu verbieten, soll es ernsthaft bringen? Es kann nämlich durchaus sinnvoll sein, fragwürdige Protagonisten einzuhegen, um ihr Wirken in harmlosere Bahnen zu lenken. Ich sag nur „Hitler und die Wiener Kunstakademie“ – mehr sag ich gar nicht. Aber gut, Leute, macht doch einfach, was ihr wollt. Das wird ohnehin eure Welt, ihr müsst damit leben.