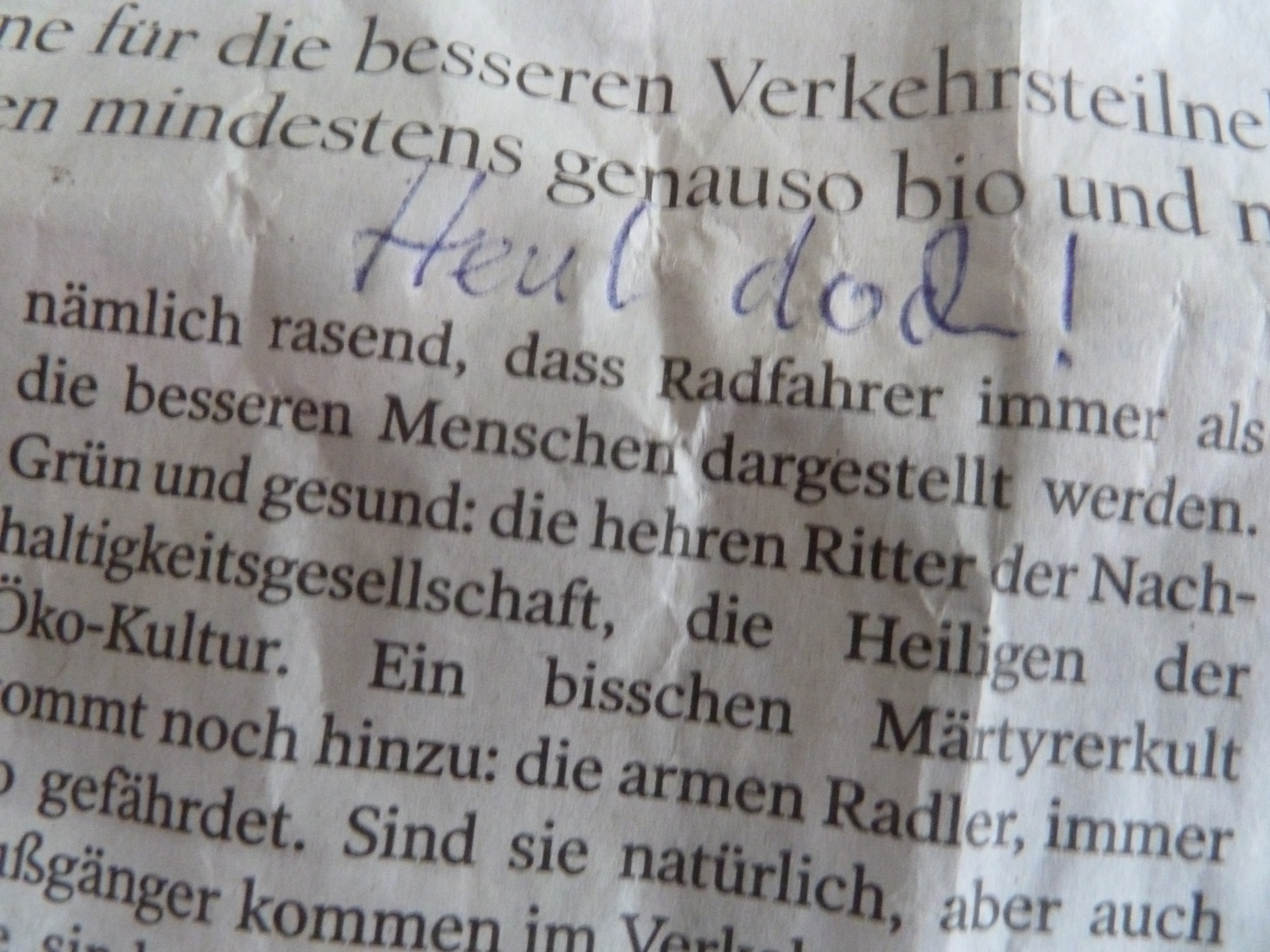
In der Tagesspiegel-Rubrik „Mehr Berlin“ bläst die Benimmspezialistin Elisabeth Binder zur Jagd auf den Ruf der Radfahrer. Ihre Waffe: die doppelläufige Moralkeule: „Ich hasse sie, diese Heiligenscheine, mit denen sich Radfahrer in der Öffentlichkeit gerne schmücken.“
Der gelegentliche Ärger mit unangenehmen Exemplaren der Spezies, veranlasst sie dazu, klapsmühlenartig zu wiederholen, wie sehr es sie ärgere, „dass Radfahrer immer als die besseren Menschen dargestellt werden.“ Den Höhepunkt ihrer Jammerarie bildet eine Art gesungener Fieberwahn aus dem Märchenland der toten Träume: „Die Radler haben eine knallharte Lobby.“
„Weniger Berlin“ wäre oft „Mehr Berlin“. Ich möchte mir die Haare büschelweise ausrupfen, die Augen gen Himmel verdrehen, bis nur noch das Weiße zu erkennen ist, irre vor mich hinkichern und mir dabei mit dem Zeigefinger hochfrequentig über die vorgeschobene Unterlippe fleppen: Autobahnen, der Volkswagen, Kraft durch Freude, Freude durch Tempo, Tempo durch autofreundliche Ampelphasen, autofreundliche Ampelphasen für das autogeilste Land der Welt, Exportweltmeister, milde Verkehrsstrafen, hohe Geschwindigkeiten, Rasen als Sex, eine fortwährende Penetration durch AudiBMWMercedesPorschebrummbrumm. Radler umgenietet, Fußgänger überrollt, dududu, das kostet jetzt aber zweitausend Euro, hammses passend, danke schön und weiterhin gute Fahrt!
Ja, schon klar, oder? Die Dame hat doch echt ein Wahrnehmungsproblem. Schwallt, schwadroniert, deliriert im Verlaufe des Artikels noch weiter von den „selbstverliehenen Heiligenscheinen der Radfahrer“ – dagegen wirkt Donald Trumps Lügenkosmos wie die Kritik der reinen Vernunft.
Natürlich gibt es aggressive Scheißradfahrer, aber das sind dann eben Arschlöcher. Egal, was sie tun, in jedem Verkehrsmittel und in jeder Lebenslage. Sie verprügeln ihre Frauen, Kinder und Hunde. Weil sie sie lieben zwar, denn eine andere Form, ihre Zuneigung zu zeigen, haben sie nicht gelernt. Sie haben immer recht und rasten bei der kleinsten Kleinigkeit komplett aus. Sie haben die Impulskontrolle eines defekten Polenböllers. Da ist es allemal besser, sie fahren mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto oder gar dem Panzer, davon würde doch alles nur noch schlimmer.
Häufig ist hier der Phänotyp mit Mountainbike und Ballonreifen, gern in Tarnkleidung oder dunklen Hoodies. Sein Leben ist ein Computergame namens „Streets of Warcraft“, durch das er sich als postapokalyptischer Straßenkrieger à la „Mad Max“ bewegt, sehr gerne auch noch in Begleitung eines unangeleinten, durchfallfarbenen Werwolf-Warzenschwein-Mischlings. Ziel das Spiels: Alle Feinde sind tot, Definition von „Feind“: jeder. Das Böse kann aber durchaus auch die Gestalt einer Touristin mit Hollandrad und hörschutzgroßen Kopfhörern annehmen. „Die besseren Menschen“, sind das jedenfalls nicht. Haben sie allerdings auch nie behauptet. Wie sollten sie denn – so weit können die doch gar nicht denken. Wir wissen nicht, aus welchem Paralleluniversum Frau Binder ihre Wahrheiten bezieht.
Klar, kann man persönliche Defizite mit dem von der jeweiligen Person bevorzugten Verkehrsmittel verknüpfen, um in der Folge die Gruppen pauschal gegeneinander auszuspielen. Man kann auch in die Kirche kacken. Doch auch dabei käme stets nur eine einzige Erkenntnis raus: Am schlimmsten sind sowieso die Fußgänger.
Nehmen wir zum Beispiel die Infanterie. Man hat diesen Kampffußgängern kein Pferd, keinen Panzer und kein Flugzeug anvertraut, da sie sogar innerhalb der blutrünstigen und dummen Militärmaschinerie noch als unzivilisierter Abschaum gelten. Sie morden, plündern und brandschatzen auf ihren weitläufigen Spaziergängen quer durch andere Länder, die sie überfallen haben. Zu Fuß verfügen sie über genügend Muße. Sie müssen auch nicht auf den Verkehr achten – die Straßen und Brücken haben sie auf ihrem Vormarsch längst gesprengt.
Auch Amokläufer sind fast immer zu Fuß unterwegs, wie ja bereits der Name sagt. Da können sie nämlich besser treffen als vom Rad herunter oder aus dem Auto heraus. Friedliche Absichten sehen anders aus.
Bezeichnend überdies, wie nachteilig sich eine Metamorphose vom Autofahrer hin zum Fußgänger auswirkt: Neulich erst räumte vor meinen Augen ein Auto beim Rechtsabbiegen beinahe einen Radler vom Sattel, der erschrak, „hey“, rief und mit der flachen Hand vorne auf die Kühlerhaube patschte.
Der Fahrer des Wagens bremste, stieg aus und wurde so zum Fußgänger. Eben noch ein lammfrommer Autofahrer, dem man allenfalls einen Mangel an Konzentration, Rücksicht, Fahrvermögen und Respekt vor dem menschlichen Leben hätte vorwerfen können, ging der frischgebackene Fußgänger nun wie ein Berserker brüllend auf den Radfahrer los und – typisch Fußgänger! – schlug ihm die Faust ins Gesicht, so dass dieser rückwärts über seinen Drahtesel fiel. Wäre er Autofahrer geblieben, wäre das alles nicht passiert. Ein Auto schlägt nicht zu. Ein Auto schreit nicht. Es hupt höchstens mal ein bisschen.
